|
| |||||||||
|
Selbsthilfe bei Schüchternheit und sozialer Phobie | |||||||||
|
Übersicht |
Rundbrief Oktober 2021
Zurück zur Rundbrief-Übersicht Der 100. Rundbrief des intakt e.V. - alle 2 Monate seit April 2005
 
Seelische Erkrankung: Was sage ich Familie, Freunden und Arbeitgeber?
Wenn Menschen psychisch erkranken, leiden sie oftmals das erste Mal in ihrem Leben unter einer seelischen Störung, die sie verunsichert, aus der Bahn wirft und vor wichtige Entscheidungen stellt. Dazu gehört unter anderem die Abwägung darüber, ob und wie man Personen aus dem engsten Umkreis in die Krankheitsgeschichte einbezieht. Ist es sinnvoll und notwendig, Angehörigen zu sagen, was los ist? Welche moralische Verpflichtung habe ich ihnen gegenüber, sie an meiner Diagnose teilhaben zu lassen? Und wie steht es um das weitere Umfeld: Bin ich Freunden, Bekannten oder gar dem Arbeitgeber Rechenschaft schuldig? Viel Unklarheit führt dazu, dass sich Betroffene zurückziehen und sich gar niemandem anvertrauen, obwohl das für die Bewältigung des Leidensdruck hilfreich ist. Gegenüber den engsten Bezugspersonen sollte eigentlich stets über die psychische Krankheit aufgeklärt werden, immerhin sind sie oftmals direkt in die Erkrankung eingebunden, indem sie veränderte Verhaltensweisen wahrnehmen, Ohnmacht gegenüber den belastenden Symptomen ihres Angehörigen verspüren oder gar für gedankliche Rückversicherung in Anspruch genommen werden. Nicht selten ist die Überforderung für nahestehende Menschen höher als für den Betroffenen selbst. Letztlich empfinden sie große Hilflosigkeit, können aber die Souveränität und Würde des Erkrankten nicht angreifen und müssen sich daher auf dessen Rationalität und Eigenverantwortung verlassen, solange er nicht selbst- oder fremdgefährdend denkt oder handelt. Niemandem kann Unterstützung aufgezwungen werden, sodass den Angehörigen nur das immerwährende Angebot zur Hilfe bleibt. Umgekehrt gilt allerdings ebenso: Sofern der Erkrankte den Eindruck hat, wonach die nächsten Verwandten aus bestimmten Gründen eine seelische Störung nicht annehmen oder ernstnehmen wollen, gebietet sich die Inanspruchnahme einer Familienberatung. Generell gibt es keine pauschale Aussage darüber, wie man gegenüber Freunden, Bekannten und der Öffentlichkeit mit einer eigenen (psychischen) Erkrankung umgehen soll. Dies ist eine Abwägung, die von der Art des seelischen Leidens, Persönlichkeitseigenschaften des Betroffenen und dem Umfeld an sich abhängt. Insofern kann es keine Empfehlungen zu Offenheit oder Transparenz geben, wenngleich viele Erkrankte berichten, dass ein offensives Umgehen mit den Beeinträchtigungen dabei hilft, die Krankheit als ein Phänomen zu akzeptieren, welches mittlerweile gesellschaftlich weit verbreitet ist. Sie beschreiben vor allem, dass das "Versteckspiel" sehr viel Kraft benötigt und dadurch das eigentliche Störungsbild weiter befeuert werden kann. Gleichermaßen erzählen viele Betroffene, wonach es überaus beschwerlich ist, den Ballast eines Geheimnisses dauerhaft umherzutragen. Selbstredend scheint es nicht hilfreich und sinnvoll zu sein, mit den eigenen Krankheiten insofern "hausieren" zu gehen, dass dem Umfeld - beispielsweise aus dem Bedürfnis nach Mitgefühl - die Beschwerden aufgedrängt und ohne dessen Nachfragen serviert werden. Das "gesunde Bauchgefühl" sollte ein entsprechender Wegweiser sein, welches Vertrauen zwischen dem Erkrankten und dem weiteren Umkreis besteht. Daran kann man festmachen, ob die Erwähnung der Erkrankung zielführend sein kann - zum Beispiel, weil sie manche Verhaltensweisen entsprechend erklärt. Es rät sich ein portionsweises Offenlegen an, über dessen Umfang und Inhalt der Betroffene selbstbestimmt entscheidet. Man ist nicht auskunftspflichtig, dennoch kann die Aussprache erleichtern und mögliche Spekulationen des Gegenübers schlussendlich beenden. Beim Arbeitgeber gilt zunächst: Niemand ist verpflichtet, dem Vorgesetzten Details einer bestehenden (psychischen) Erkrankung zu offenbaren. Auch ist nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz eine Frage des Chefs zu einer Schwerbehinderung im laufenden Beschäftigungsverhältnis zunächst unzulässig. Dies gilt auch gegenüber Personen, die einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind. Allerdings hat die höchstrichterliche Rechtsprechung ergeben, dass nach sechs Monaten seit Beginn der Anstellung eine diesbezügliche Frage insbesondere dann zulässig ist, wenn der Arbeitgeber aufgrund der Schwerbehinderung bestimmte Schutzvorschriften beachten muss, beispielsweise vor einer anstehenden Kündigung. Eine Mitteilung über die bestehende Behinderung scheint immer dann sinnvoll und notwendig, wenn sich der Arbeitnehmer daraus bestimmte Nachteilsausgleiche erhofft (zum Beispiel Zusatzurlaub, behindertengerechter Arbeitsplatz, Förderung der Integration, Ausgleichsabgabe und Beschäftigungspflicht, Zustimmung zum Ende des Arbeitsvertragsverhältnisses, Prävention oder Benachteiligungsverbot). Der Chef kann in diesen Fällen als Nachweis den Schwerbehindertenausweis zur Ansicht verlangen, es sei denn, die Schwerbehinderung ist offensichtlich. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Frage nach dem Umgang mit einer Krankheit gegenüber dem persönlichen Umfeld stets eine Einzelfallentscheidung bleibt. Niemand sollte sich zur Darbringung von Feinheiten über eine psychische Erkrankung genötigt sehen, denn es obliegt jedem Betroffenen - auch im Falle von schwerwiegenden Störungsbildern -, den Bewältigungsprozess aus eigenem Antrieb heraus zu gestalten. Dennis Riehle Psychologischer und Psychosozialer Berater Sozialrecht (zertifiziert) | Integrationsberater | Coaching Tel.: 07531/955401 Mail: Beratung(ä)Riehle-Dennis.de Alle Angaben ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität! Haftung ist ausgeschlossen! Es kann lediglich eine Allgemeine Sozialgesetzaufklärung erfolgen. Juristische Einzelfallbewertungen sind Rechtsanwälten vorbehalten.   
Hilfestellen in Braunschweig Teil 4 Hier ist nun die schon dritte Erweiterung der Hilfenliste. Seht sie alle durch, es existiert mehr als gedacht. Es finden sich Hilfen für Probleme, die von vielen schon als "unlösbar" abgehakt wurden. Und natürlich gilt auch diesmal: Solche Angebote hat man nicht nur in Braunschweig. In anderen Städten heißen sie zwar anders, aber sie sind da. Nutzt sie! (Die ersten Teile sind online: www.schuechterne.org/rb203.htm, //rb205.htm, //rb212.htm) Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) Wilhelmstraße 5 38100 Braunschweig Tel.: 0531 / 480 960 E-Mail: braunschweig(ä)dgb.de Web: www.suedostniedersachsen.dgb.de Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Braunschweig Leopoldstraße 5 38100 Braunschweig Mo, Di: 13 - 18 Uhr Do, Fr: 9 - 14 Uhr Tel.: 0531 / 128708 17 und 0531 / 128708 18 E-Mail: info(ä)eutb-bs.de Web: www.eutb-bs.de Lebenshilfe Braunschweig Fabrikstraße 1 F 38122 Braunschweig Telefon 0531 / 47190 E-Mail: info(ä)lebenshilfe-braunschweig.de Web: www.lebenshilfe-braunschweig.de Männerberatungsstelle Braunschweig Christof Görlich Maschplatz 13 38114 Braunschweig Tel.: 0531 / 57 94 51 E-Mail: christofgoerlich(ä)arcor.de Web: www.wir-fuer-braunschweig.org/braunschweiger-initiativen/soziale-initiativen (dort auf Seite 8 unter Buchstabe M) Sozialamt (Soziale Sicherung, Behindertenhilfe, Rechtsangelegenheit) Naumburgstraße 25 38124 Braunschweig Tel.: 0531 / 4708945 Fax: 0531 4708912 E-Mail: soziale.hilfen(ä)braunschweig.de Web: www.braunschweig.de/leben/senioren/05_finanzielle_leistungen/sozialhilfe.php Trauerbegleitung e.V. Lincolnstraße 47 38112 Braunschweig Tel.: 0531 / 124340 E-Mail: kontakt(ä)trauerbeistand-ev.de Web: www.trauerbeistand-ev.de Versorgungsamt Schillstraße 1 38102 Braunschweig Tel.: 0531 / 70190 E-Mail: PoststelleLSBraunschweig(ä)ls.niedersachsen.de Web: www.braunschweig.de/vv/oe/0/versorgung/index.php?cg_at_id=0 Weißer Ring Braunschweig Tel.: 0151 / 55164638 E-Mail Braunschweig: matthias-jago(ä)t-online.de E-Mail landesweit: info(ä)weisser-ring.de Web: www.braunschweig-niedersachsen.weisser-ring.de Wir für Braunschweig Soziale Initiativen (Übersicht über 100 Stück) Madamenweg 107 38118 Braunschweig E-Mail: kontakt(ä)wir-fuer-braunschweig.org Web: www.wir-fuer-braunschweig.org/braunschweiger-initiativen/soziale-initiativen   
Schöne Antworten auf unschöne Sprüche
Die Bundestagswahl ist gewesen. Sie beantwortet eine neudeutsche Frage der jungen Menschen unter 16, nämlich: "Kann auch ein Mann Bundeskanzlerin werden?" Nun - nach der Wahl - kann ich den angekündigten parteipolitischen Text nachreichen. Ich hatte ja angekündigt, daß ich einen Artikel lang die parteipolitische Neutralität vergesse. Der intakt e.V. ist zwar parteipolitisch und religiös neutral. Aber das gilt natürlich nur gegenüber solchen Parteien und Religionen, die uns gegenüber neutral sind. Ich kenne die Grenze zwischen Toleranz und Selbstmord. Eine der nicht-toleranten Parteien sieht zwar aus wie die "Linke" - die Kopie (→1) geht bis zum roten Dreieck als I-Punkt - aber steht am ganz anderen Ende: "Die Rechte". Der Kommunalkandidat dieser Partei stand auf dem Wahlzettel mir "Rentner, geb. 1970". Fordert diese Partei etwa die Rente mit 51? Naja, gewählt habe ich sie trotzdem nicht. Der Grund zeigt sich im Spruch, den die Partei auf ihre Plakate schrieb. Ach ja, immer wieder das Kleingedruckte... 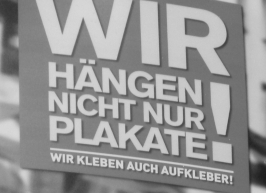 Der Spruch ist ein sogenannter "Vexiervers" - der das Unsagbare erst andeutet und erst im zweiten Teil doch noch auf harmlos abdreht. Sowas ist ja extrem beliebt, Beispiele kommen sofort in den Sinn: "Wir ziehen los mit ganz großen Schritten, und Erwin faßt der Heidi von hinten an die Schultern." (→2) Über den ideologischen Hintergrund des Spruchs möchte ich hier nicht schreiben. Das tun andere um so länger und erregter. Schnell kommt bei solchen Leuten die Forderung, die Aufklärung über die Nazizeit zu verstärken, soll heißen: die ganze Guidoknopperei nochmal zu verdoppeln. Dabei widerlegt schon der Spruch die Vermutung, die Rechten würden nicht wissen, wie schlimm das damals war. Nein, sie wissen es ganz genau. Sonst würden sie nicht genau damit provozieren. In anderen rechten Gruppen passen die ehrliche Trauer für die NS-Opfer und Hetze gegen heutige Minderheiten sogar nahtlos zusammen. Aber das alles ist nicht der Anlaß für diesen Text. Eigentlich sollte ich noch nicht mal das Plakat hier erwähnen und damit das Spiel dieser Partei auch noch mitspielen. Letztendlich werden solche Parteien nicht aus eigener Kraft bekannt, sondern durch die Empörungswelle der Gegenseite. Wenn nicht auch andere auf die rechte Provokation eingestiegen wären - besser gesagt nicht eingestiegen, sondern auf ihre Art kommentiert: die "PARTEI". Diese Satirepartei möchte ich hier nicht bewerten, ihr gegenüber gilt wieder die oben erwähnte Neutralität. Und auch sie spielt mit der Andeutung von Gewalt. 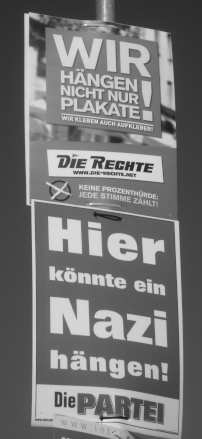 Aber wie sie ihren eigenen Spruch mit dem der Rechten kombiniert hat, das hat was! Es stellt die Worte "Nazi" und "hängen" wieder in den eigentlichen Zusammenhang. Und das noch ohne irgendwelches Niewiederhilfehilfeschlimmschlimmschlimm. Im Gegenteil, das Lachen über diese Kombination kann Menschen erreichen, die von betroffenem Aktionismus abgeschreckt werden (→3). Aber wie sie ihren eigenen Spruch mit dem der Rechten kombiniert hat, das hat was! Es stellt die Worte "Nazi" und "hängen" wieder in den eigentlichen Zusammenhang. Und das noch ohne irgendwelches Niewiederhilfehilfeschlimmschlimmschlimm. Im Gegenteil, das Lachen über diese Kombination kann Menschen erreichen, die von betroffenem Aktionismus abgeschreckt werden (→3).Es ist mal wieder ein Beispiel für "positives Querdenken", den eigenen Weg finden, die schlimmen Welt mit eigener Stärke zu beantworten. Was hat das alles mit sozialer Angst zu tun? Wenig - aber um so mehr mit nötiger Kreativität. Wer aus einem Problem raus will, muß Ideen haben, muß was anderes machen als bisher. Muß eigene Gedanken einsetzen, wo scheinbar Mitschwimmen und Nachplappern erwünscht sind. Noch näher an der Erlebniswelt der unfreiwillig Schwachen, der Gemobbten und Ausgegrenzten: Die Antwort der "PARTEI" zeigt die Fähigkeit, schlimmste Gegner mit einem einzigen Satz lächerlich zu machen. Es ist gut, das zu können. 99,9% von uns sind schließlich keine "Promis mit politisch korrekter Identität", denen eine Empörungskampagne beisteht, wenn sie beleidigt werden (→4). Wir müssen uns selbst helfen. Diese geistige Beweglichkeit läßt sich trainieren und steht im engsten Zusammenhang mit Selbstbewußtsein. Beides stützt sich gegenseitig, wenn es wächst. Julian / Braunschweig
  
Nur wer die Wurzel kappt, löst das Problem...
Was hält den Zwang am Leben? Viele Betroffene, bei denen sich die Zwangsstörung chronifiziert hat, stellen sich diese Frage. Denn oftmals geben die Zweifel trotz hinreichender Medikation und einer intensiven Psychotherapie keine Ruhe. Scheinen sie einmal besiegt zu sein, kommen sie nicht selten nach einiger Zeit zurück. Natürlich wären sie keine Zwänge, würden sie es aufgeben, unseren Kopf zu drangsalieren. Dennoch bewegt mich die Überlegung, welcher Misthaufen in unserer Seele vor sich hin brodelt und es verhindert, dass unsere Psyche sich einmal entspannen kann. Die unterschiedlichen Erklärungsansätze aus der Verhaltenstherapie befriedigen mich nur bedingt, immerhin liefert das Gedankenmodell der Konditionierung, wonach sich ein neutraler Reiz mit einem angstauslösenden Ereignis zu einem negativ konnotierten Gedanken verbindet und in der Folge durch den Betroffenen immer wieder zu neutralisieren versucht wird, nur unzulängliche Aussagen darüber, warum bestimmte Menschen für diesen Prozess anfällig sind und er bei ihnen operant bleibt. Auch die lerntheoretischen Begründungen, die davon ausgehen wollen, dass Zwänge auf behavioralem Verhalten fußen - sodass Menschen vom Seelenleben losgelöst eine Automatisierung erleben, welche sich in der furchtsamen Bewertung von objektiv normalen Impulsen zeigt -, scheinen mir ungenügend zu sein. Zwar erklären sie die Entstehung dieses Handlungsmusters durch verschiedene Auslösefaktoren wie dysfunktionale oder moralische Glaubenssätze. Dennoch bleibt auch hier die Möglichkeit, wonach es für die Fortdauer einer Zwangserkrankung eine Wurzel gibt, letztlich vollkommen unbeachtet. Insofern erachte ich auch die rein auf Konfrontation ausgerichtete Psychotherapie, die das Reaktionsmanagement des Betroffenen regulieren soll, ebenso wie das Habituationstraining, welche lediglich symptomorientiert auf einen Gewöhnungseffekt abzielt, als nicht ausreichend genug, um die Komplexität der Erkrankung zu erfassen. Wer mich kennt, weiß um meine besondere Beziehung zur psychodynamischen Sichtweise. Ich befürworte diese psychotherapeutische Schule auch deshalb, weil ich der festen Überzeugung bin, dass nicht allein biochemische Zuschreibungen genügen, um den Erhalt von Zwängen zu rechtfertigen. Es gibt Hinweise darauf, dass neurotische Störungsbilder nur deshalb aufrechterhalten bleiben, weil sie durch verschiedene Stressoren befeuert werden. Und letztlich zeigen sich bei Betroffenen unter genauerem Hinsehen zahlreiche Konflikte im Unterbewusstsein, die unverarbeitet ein Stillleben führen, das die Entstehung und Verfestigung psychischer Krankheiten katalysiert. Denn solange in uns eine Glut glimmt, genügt der Hauch eines hektischen Alltags, um neue Flammen zu entfachen. Seelische Erkrankungen nehmen die Funktion ein, uns auf diese vergessen geglaubten Verwundungen in unserem Inneren hinzuweisen und uns aufzufordern, an ihrer Heilung zu arbeiten. Für viele Menschen ist dies ein unangenehmer Gedanke, denn wie oft möchten wir uns vor Vergangenem säumen und lehnen es ab, in der eigenen Biografie zu graben. Auch gegenwärtige Probleme schieben wir gern beiseite - nicht nur deshalb, weil es heutzutage kaum mehr in das Gesellschaftsbild passt, verletzlich zu sein. Die Befassung mit früheren oder aktuellen Belastungen nimmt uns Zeit und strengt uns an, weshalb wir sie lieber unterdrücken. Gerade in einer Epoche des Perfektionismus passt es nicht, Schwächen zuzugeben. Trotzdem - und gerade deshalb - lohnt es sich, einige Kraft im Hier und Jetzt aufzuwenden, um den Widerstreit in unserer Seele anzusehen, statt mit ihm in ständiger Verborgenheit durch das Leben zu wandeln und wiederkehrend von Zwängen heimgesucht zu werden. Doch was können nun diese zugeschütteten Auseinandersetzungen in uns sein, die wir nur dann lösen können, wenn wir uns an die Wurzel wagen und sie kappen? Zwanghaftes Verhalten und Denken ist ein sinnbildlicher Ausdruck für Unfreiheit. Daher sind oftmals Einengungen und Abhängigkeiten im Alltagsleben eine mögliche Ursache für das Weiterbestehen der Erkrankung. Neben rigiden Normenvorgaben in der Erziehung können auch derzeitige Angewiesenheiten in Frage kommen: Ob das Dasein im Zwang von Sozialleistungen, in familiären Banden, im unzufriedenen Beschäftigungsverhältnis oder im ungelebten Lebenstraum - unser Liberalismus wird immer häufiger von Unmündigkeit beschnitten. Sich aus der Knechtschaft von Obsessionen zu entsagen, kann für viele Betroffene nicht nur einen Zugewinn von existenzieller Qualität bedeuten. Auch die Wahrscheinlichkeit, wonach sich das Krankheitsbild rückbildet, stehen dann recht gut. Nahezu bei jedem Betroffenen sind Zwänge auch ein Ausdruck vernachlässigter oder nicht wahrgenommener Emotionen. In uns schlummern jederzeit gegenläufige Gefühlsströmungen, die im schlechtesten Fall unbemerkt unter der Oberfläche ihre Kämpfe austragen. Dass Erkrankte der Zwangsstörung oft Schwierigkeiten damit haben, Aggressionen zu zeigen oder auch Empathie zu äußern, dürfte hinlänglich bekannt sein. Daher ist es wichtig, die affektive Schwingungsfähigkeit zu praktizieren. Denn nur ausgelebte Empfindungen wirken befreiend und entlastend. Und nicht zuletzt finden sich bei vielen Erkrankten Persönlichkeitsstrukturen als antreibender Motor für die Zwänge. Häufig sind es antiquierte Wertegerüste, welche schon in Kindheit aufoktroyiert wurden und seitdem nicht mehr hinterfragt worden sind, die einen Verhaltenskodex konservieren, welcher unbedingt in der Lage ist, in den Gesang der Erkrankung einzustimmen und sie lebendig zu halten. Zusammenfassend wird deutlich: Damit eine Zwangserkrankung aktiv bleiben kann, braucht sie Nahrung. Gerade, wenn wir uns darauf fokussieren, allein die äußerlich sichtbaren Zeichen der Störung zu verarzten, wabert es in unseren Tiefen weiter. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie anspruchsvoll es ist und welche Überwindung es braucht, sich den verdeckten Abläufen unserer Seele zu stellen. Doch ich kann auch berichten, dass sich die Mühen durchaus auszahlen: Ich bin der Meinung, dass sich meine Zwänge mittlerweile vor allem deshalb stabilisiert haben, weil ich mein Wesen aufgeräumt habe. Insofern ermutige ich Mitpatienten, sich der Strapaze einer intensiven Aufbereitung von möglichen Beweggründen zu öffnen und damit letztlich den Weg zu ebnen, um nachhaltige Besserung der Symptomatik zu erzielen. Denn wer schon einmal längere Zeit unter den Kräfte zehrenden Zwängen gelitten hat, wird anerkennen können, dass ein großer Input nötig und angemessen ist, um schlussendlich zu einem gewinnbringenden Outcome zu kommen. Kontaktmöglichkeit zum Autor: Riehle(ä)Riehle-Dennis.de Dennis Riehle | Martin-Schleyer-Str. 27 | 78465 Konstanz | www.dennis-riehle.de   Zurück zur Rundbrief-Übersicht Zurück zur Rundbrief-Übersicht | ||||||||
Diese Seite wurde automatisch erstellt mit JULIAN'S MACHSEIT Perlscript
zuletzt am 16.07.2023 um 12 Uhr 26
